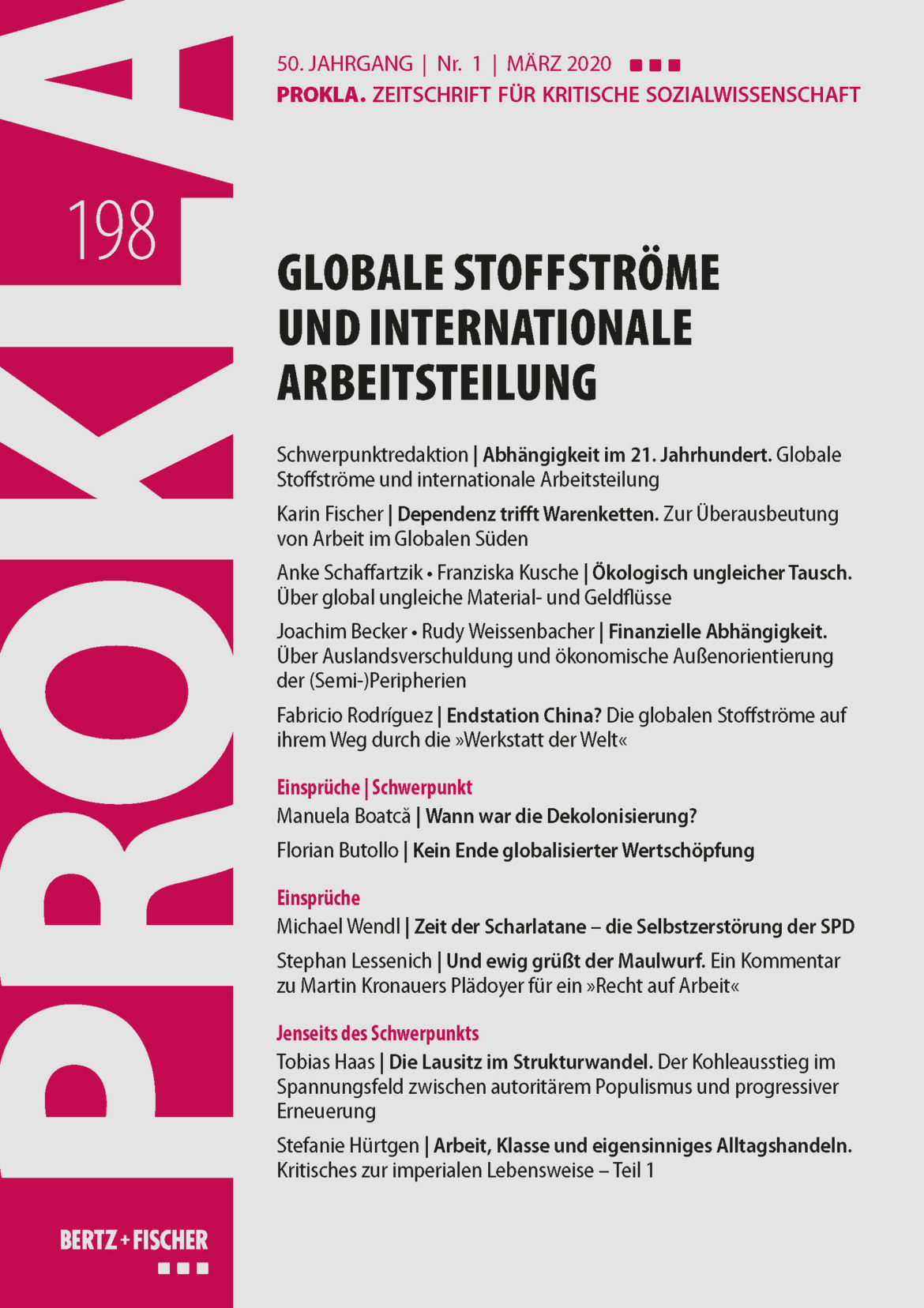Preface to the Portuguese translation of The Imperial Mode of Living von Markus Wissen and Ulrich Brand, Ed. Elefante, São Paulo (2021).
Link: https://elefanteeditora.com.br/produto/modo-de-vida-imperial/
Citation: Brand, Ulrich, and Markus Wissen (2021): Modo de vida imperial: sobre a exploração de seres humanos e da natureza no capitalismo global. First Edition. Elefante.
[source of picture: https://unsplash.com]